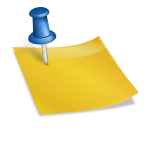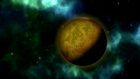Ich sprach auf der Straße zu dem alten Mann. Er war wirklich schon sehr alt und hatte, wie er sagte, das Leben gesehen. Sein grauer Hut saß fest auf seinem harten und kahlen Gesicht und verrückte nicht, zitterte nicht mal, war grundfest.
Nein, er bewegte sich nicht. Auch nicht, wenn der Mann aus seinem ausgedehnten und spannungslosen Mund Worte herauskaute. Er hatte das Leben gesehen. Seine künstlichen Zähne mahlten jeden Laut, jede Silbe, jedes Wort einzeln aus der Tiefgründigkeit dieses Mannes, obwohl er nur oberflächlich war, oder schien. In der Hand hielt er einen farblosen, alten, verbrauchten Regenschirm; knitterig, blass.

Er bezweifle nicht, so sagte er mir, dass die Zukunft ungewiss sei, ja völlig nebulös und im Unklaren. Er bezweifle nichts. Denn die junge Generation würde sicherlich viele Schwierigkeiten erben. Nicht nur die Vergiftung und Ausbeutung der Umwelt, nein, vielmehr: eine von Grund auf falsche Weltsicht. Erst gestern habe er gesehen, dass wieder so ein Öltanker auf der Autobahn verunglückt und ausgelaufen sei, direkt und nahe an einem Naturschutzgebiet hätte sich die klebrige Masse in die Erde gefressen. „Die armen Vögel“, dachte ich.
Man musste wohl alles abgraben. Einen Führerschein hatte ich nicht; das tröstete mich zwar nicht, erleichterte mir aber mein Gewissen. Immerhin war ich ja nicht schuld. Es regnete.
Früher habe er auch geglaubt, so erklärte er, dass man einen Stein auf den anderen setzen müsse, behutsam vorangehen, um das Ziel zu erreichen. Heute wisse er dagegen, dass das einzige Ziel sein könne, soviel an der Welt als möglich anzurichten, sie zu zerrütten und zu zerstören: Der Größte sei der, der die größten Fußabdrücke hinterlasse, Spuren der Zerstörung.
Gestern schien noch die Sonne, heute regnete es. Das brackige Regenwasser sammelte sich an der Ecke in zwei Mulden zu zwei großen Pfützen. Manchmal schillerte etwas regenbogenfarbig, wie Öl auf ihnen: aber wohl nur scheinbar. Die Tropfen fielen hinein, sprengten die Oberfläche und verschwanden.
Ja, er hatte das Leben gesehen. Ein blauer Schulbus fuhr vorüber. Schüler wälzten sich an den feucht-heiß beschlagenen Scheiben und stürmten darin.
Er erzählte mir von seiner Kindheit, vom Kaiserreich, vom Hakenkreuzregime, vom Krieg, wie seine junge Frau – den Namen weiß ich nicht mehr – und seine zwei kleinen Kinder, im Säuglingsalter (es waren wohl Zwillinge) umkamen, wie er nach dem Krieg wieder arbeitete, ein Geschäft aufbaute, eine neue Familie, wie er zum Schluss entlassen wurde, pensioniert, aus der Firma; aus der Ehe. Der Tod. Ja, er hatte das Leben gesehen.
Einige Tropfen fielen mir ins Gesicht, ich wischte sie mir aus den Augen. Der Regen kam nun seitwärts – oder es war der Laster, der vorbei rauschte und die Brühe seitwärts katapultierte. Kinder dachte ich, haben es besser. Sie können das Leben auch kopfüber sehen; sie stellen sich einfach auf den Kopf. Das ist nicht einfach, man fällt leicht vornüber – ich habe es oft genug ausprobiert – aber man muss erst einmal auf die Idee kommen. Kinder haben noch Ideen – manche.
Der Regen ließ nach. Mir fiel der Mann wieder ein. Er stand immer noch da. Er schaute bedrückt zu Boden. Er hatte ja das Leben gesehen. Lohnt es sich wirklich, das Leben zu sehen, das ganze Leben?, dachte ich.
Der Mann sah traurig aus. Viele sehen das Leben nur frontal, von vorn. Warum eigentlich nie rückwärts? Oder spiegelverkehrt? Oder wenigsten kopfüber, wie die Kinder?
Welche Farben das Leben hatte, das der Mann gesehen hat, ist schwer zu beurteilen, sicher ist nur, dass sie ihm nicht gefallen haben. Wahrscheinlich hat es auch etwas mit dem Regen zu tun: Regen macht träge und müde, und die meisten Leute werden melancholisch, wenn es regnet. Ich sagte vorher, dass der Mann einen grauen Hut auf hatte; nun, vielleicht war er ja gar nicht grau, sondern rot, oder grün, oder blau, und die Farbe war nur vom Regen ausgespült? Vielleicht sah ich die Farben auch nur nicht, weil mir der Regen ins Gesicht fiel, und ich nicht richtig erkennen konnte. Ja, vielleicht regnete es auch gar nicht, und die Spritzer, die meine Augen betäubten, kamen nur von der feuchten Aussprache, als er jedes Wort, jede Silbe, jeden Laut einzeln aus sich krümelte. Es ist soviel möglich – ich weiß es nicht.
Es hatte zu regnen aufgehört und der Mann schaute mich erwartungsvoll an. Ich suchte nach einer intelligenten Antwort und fragte ihn schließlich, was er wohl für die Zukunft vorhätte. Der Mann erschauderte und starrte mich entsetzt an. Er war ratlos und blieb es für eine Weile. Der Himmel verdüsterte sich langsam wieder.
Ich bemerkte, dass ich ganz nass war und versuchte, mich darauf zu besinnen, was ich hier eigentlich wollte, hier, mitten auf der Straße, bei einem alten Mann, aber es fiel mir nicht ein. Ich kannte ihn noch nicht mal. Obwohl er das Leben gesehen hatte, wie er sagte. Ich war ratlos.
Es begann wieder zu regnen. Der blaue Schulbus fuhr wieder um die Ecke, zurück zum Anfang, diesmal ohne Schüler; man hatte sie irgendwo ausgesetzt. Die Pfützen füllten sich wieder. Der Mann antwortete: „ Alles ist auswechselbar.“
Ich verstand ihn nicht, verließ ihn völlig verwirrt und überstürzt. Da war er völlig verbittert. Es regnete fürchterlich. Ein Bus fuhr vorbei. Alles verschwand im Grau des Regens. Ich schwamm weiter, und dachte an „Zukunft“.
Martin Dühning, aus dem Nitramica Arts „Jahrbuch 1994“ (NNZ Nr. 1)