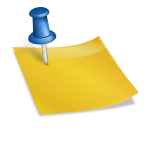Unaufhörlich im Marschschritt ticken die Uhren. In alten Sprichwörtern findet man es aber noch, das Gespür dafür, dass Zeit nicht gleich Zeit ist: „Alles hat seine Zeit“.
Eine der besonderen Erfindungen der Moderne ist die der berechenbaren Zeit: „Tick-tack, tick-tack, tick-tack…“ Als gleichbleibende quantitative Einheit betrachtet, lässt sie sich scheinbar trefflich verplanen, verrechnen oder auch ansparen. Physikalisch ist die Theorie von der Zeit als gleichbleibender Konstante zwar längst überholt, doch der Lebensalltag im 21. Jahrhundert basiert immer noch darauf, dass man Zeiteinheiten in einfacher Arithmetik aufsummieren oder abziehen und in andere Einheiten, oft auch Währungen, konvertieren kann. Nur in den sprichwörtlichen Redensarten, die wir als einzige Form von Lebenswahrheit noch akzeptieren, schwingt die Erkenntnis mit, dass man Zeit nicht kaufen kann, lagern oder irgendwie zurückerlangen. Sie ist die wohl kostbarste Ressource des menschlichen Lebens – und wie man in einem bekannten Kinderbuch nachlesen kann, ist sie im eigentlichen Sinne das Leben, und je mehr die Menschen daran herumsparen und rechnen, desto weniger bleibt ihnen letztlich davon übrig.

Zeit ist auch nicht gleich Zeit. Es gibt besondere Zeiten und solche, die sich, unabhängig von ihrer Masse, als recht nutzlos erweisen, weil es eben nicht reicht, ein gewisses Maß an Sekunden, Minuten oder Stunden, ja Tage oder Monate zu haben, wenn es nicht „die rechte Zeit“ ist. „Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit“ – man mag nun glauben oder nicht, diese allgemeingültige Erkenntnis aus dem Buch Kohelet gilt nach wie vor, auch im Zeitalter der Atomfunkuhren, des raumlosen Internets und der sogenannten „multikulturellen Gesellschaft“, die oft doch nur eine von Kultur bereinigte Gesellschaft ist, weil man jede Art von Festlegung vermeiden möchte. Doch indem man alles Feste, mitunter auch Feste, vermeidet, ent-wertet man auch große Teile seiner Lebenszeit.
Es reicht im Leben nicht, die richtigen Dinge zu tun, man muss sie auch zur rechten Zeit tun, damit sie gut werden können. Die alten Griechen nannten das Eukairos, die rechte Zeit. Die richtigen Dinge, zur falschen Zeit getan arten ebenso in Unglück aus wie die falschen Dinge, zur richtigen Zeit getan und – was der moderne westliche Mensch oft übersieht: Manchmal ist es auch nötig, zur rechten Zeit nichts zu tun, um den richtigen Augenblick geduldig abzuwarten. Das hat nichts zu tun mit dem Abzählen von Kalenderblättern oder persönlichen Terminplanern. Es ist eine Sache der Intuition, jener verkannten Form von Intelligenz, die wir jungen Menschen in immer jüngeren Jahren regelmäßig erfolgreich austreiben. Oder sagen wir: fast erfolgreich. Denn ganz funktioniert es ja „leider“ immer noch nicht. Zum Glück für die Menschlichkeit…
Es gibt besondere Tage im Jahr, wie beispielsweise die letzten eines Kalenderjahres, wo es nichts mehr groß zu erledigen gibt oder die Zeit dafür ohnehin nicht mehr reicht, da breitet sich auch heute noch regelmäßig eine Stille über die Menschen aus und sie spüren die Zeit wieder in ihrer Reinform, als Erleben. Selbst in den Berufen, in denen der Alltagsrhythmus unerbittlich auch über die „Rauhnächte“ weht, werden diese überzähligen Tage als Unwillen erfühlt, dass da doch eigentlich anderes möglich wäre. Physikalisch begründbar ist das natürlich nicht, es ist ein gesellschaftlich-kulturelles Phänomen, das mit einem anderen Kalendersystem auch austauschbar wäre, allerdings nicht für die Menschen, die darin leben. Denn Kultur ist kein Mäntelchen, in das man schlüpft und das man beliebig wechseln kann. Kultur, wenn sie echt und nicht nur Konsumevent ist, vollzieht sich als gesellschaftlich erlebte Zeit – und das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Und genau deshalb fühlen sich viele Menschen kulturell so heimatlos, weil sich die Gesellschaft doch keine Zeit mehr gönnen will, in ihrem systemimmanenten Wahn, sich zu immer größeren Leistungen aufschwingen zu müssen.
„Alles hat seine Zeit“ ist auch ein Satz, den ein Musiker unterschreiben könnte, denn es gibt nicht nur Zeit für die Klänge, sondern auch Zeit muss sein zum Verhallen. Es sind die intuitiven Pausen, in der Musik erst ihren sinnlichen Zauber bewirken kann, und je mehr wir daran sparen in unserer jederzeit tönenden Welt, desto weniger haben wir davon. Tick-tack…